Zukunft denken: Digitalisierung, Innovation & Technologie
Fax statt Fiber: Warum deutsche Behörden die Digitalisierung verschlafen
Während andere Länder längst ihre Verwaltung digitalisiert haben, hört man in deutschen Behörden immer noch das typische Piepen von Faxgeräten. Bayern will als erstes Bundesland die Faxgeräte abschaffen – trotzdem setzen deutsche Ämter nach wie vor auf diese altmodische Technik.
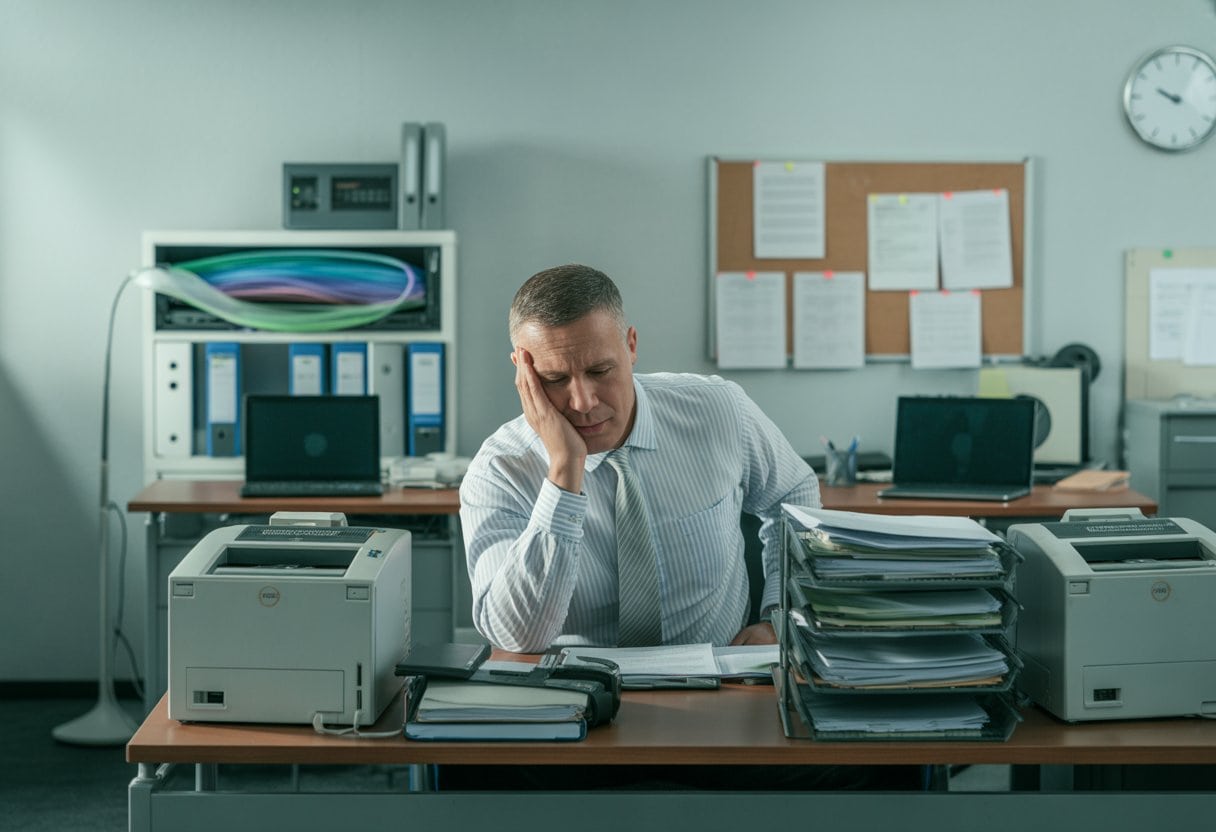
Deutsche Behörden zwingen Unternehmen und Bürger immer noch dazu, per Brief oder Fax zu kommunizieren, statt moderne digitale Lösungen bereitzustellen. Diese digitale Rückständigkeit hat echte Ursachen und Folgen, die weit über den Verzicht auf neue Technik hinausgehen.
Die Gründe reichen von rechtlichen Hürden bis zu fehlenden Standards. Es ist manchmal schon frustrierend, wie wenig sich ändert.
Hier erfahren Sie, warum deutsche Behörden bei der Digitalisierung so hinterherhinken. Dazu gibt’s Beispiele aus der Praxis und Einblicke in die Herausforderungen beim Übergang zu moderner Kommunikation.
Wir zeigen Ihnen auch, wie diese Verzögerung Wirtschaft und Gesellschaft beeinflusst. Und wie könnte die Verwaltung in Deutschland in Zukunft aussehen? Tja, das bleibt spannend.
Fax statt Fiber: Das Problem der digitalen Rückständigkeit
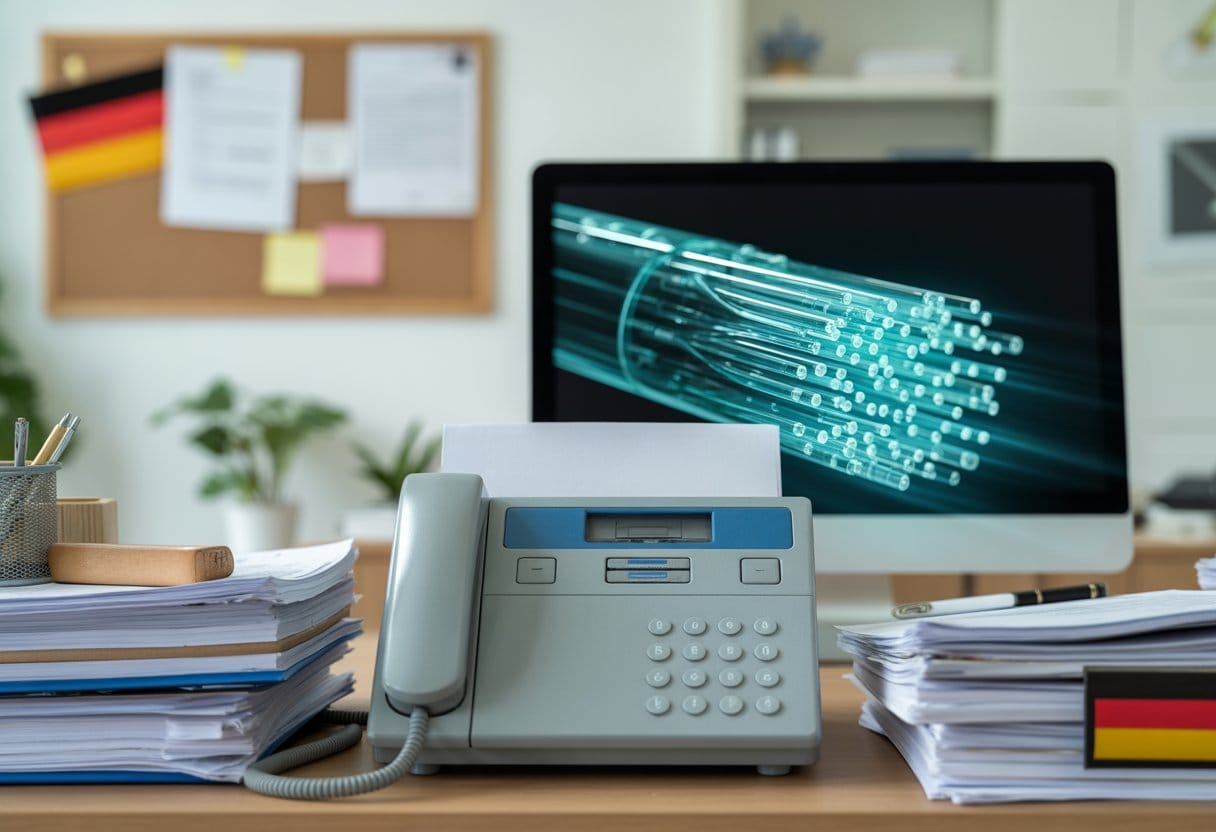
Deutsche Behörden verwenden immer noch Millionen von Faxgeräten jeden Tag, obwohl moderne digitale Lösungen längst bereitstehen. Diese Abhängigkeit von alter Technik macht die Probleme bei der Digitalisierung der Verwaltung ziemlich sichtbar.
Historische Rolle des Faxgeräts in deutschen Behörden
In den 1980er und 1990er Jahren setzte sich das Faxgerät als Standard in deutschen Verwaltungen durch. Die Behörden entschieden sich dafür, weil es schneller als die Post war und rechtlich anerkannte Dokumente übertragen konnte.
Über viele Jahre bauten sie ihre Abläufe darauf auf. Gesetze schrieben oft die Schriftform vor, und das Fax erfüllte diese Vorgaben.
Die Verwaltung mochte die einfache Bedienung und Zuverlässigkeit. Rechtliche Sicherheit spielte eine große Rolle. Gerichte akzeptierten Faxe als gültige Dokumente.
Diese lange Gewohnheit erschwert heute den Umstieg auf moderne Alternativen. Viele Abläufe funktionieren noch immer nur mit Fax.
Gegenüberstellung: Fax versus moderne digitale Kommunikation
Moderne digitale Kommunikation bietet viele Vorteile gegenüber dem Fax.
Geschwindigkeit und Effizienz:
- E-Mail: Kommt sofort an
- Fax: Dauert Minuten pro Seite
Kosten:
- Digital: Nach der Einrichtung praktisch kostenlos
- Fax: Telefongebühren und Papier
Umwelt:
- Digital: Kein Papier nötig
- Fax: Papier und Toner werden verbraucht
Speicherung und Suche:
- Digital: Automatische Archivierung, leicht durchsuchbar
- Fax: Manuelle Ablage, schwer auffindbar
Behörden halten trotzdem am Fax fest. Sie argumentieren mit Rechtssicherheit und Interoperabilität.
Diese Gründe überzeugen aber immer weniger, weil digitale Alternativen längst ähnliche Anforderungen erfüllen.
Status quo der Faxnutzung in deutschen Verwaltungen
Bayern macht als erstes Bundesland ernst und reduzierte die Zahl der Faxgeräte von 3.766 auf 1.869 zwischen Dezember 2023 und August 2024. Minister Fabian Mehring sagte, man wolle dem „Fax in der öffentlichen Verwaltung den Stecker ziehen“.
Andere Städte ziehen nach:
- Köln: Verwaltung will bis 2028 auf Faxgeräte verzichten
- Frankfurt am Main: Reduzierte von 2.500 auf wenige Hundert Geräte
- Bundestag: Letzte Faxgeräte im Juni 2024 abgeschafft
Trotzdem verschicken und empfangen Behörden, Krankenhäuser und Versicherungen täglich Millionen Faxe. Sie halten daran fest, weil sie Fax für sicher und rechtlich zuverlässig halten.
Die Pandemie brachte das Fax als Symbol für digitale Rückständigkeit in Deutschland besonders in die Kritik. Gesundheitsämter übermittelten Corona-Daten per Fax – das sorgte für Verzögerungen.
Private Unternehmen sind da schon weiter. Laut Bitkom-Studie haben vier von fünf Firmen das Fax längst abgeschafft.
Ursachen: Warum deutsche Behörden die Digitalisierung verschlafen

Strukturelle Probleme in der Politik, alte Technik und Kompetenzstreitigkeiten zwischen Bund und Ländern bremsen die Digitalisierung der Behörden aus. Das alles verstärkt sich gegenseitig und macht Reformen schwierig.
Politische und verwaltungsinterne Hemmnisse
Die Verwaltung bleibt oft lieber beim Altbewährten, statt Neues zu wagen. Viele Beamte fürchten sich vor Veränderungen und halten an alten Abläufen fest.
Rechtliche Hürden machen den digitalen Wandel mühsam. Viele Gesetze verlangen immer noch die Schriftform. Fax gilt als rechtssicher, digitale Alternativen sorgen für Unsicherheit.
Die fehlende politische Priorität hemmt den Fortschritt zusätzlich. Digitalisierung kostet viel, bringt aber erst später sichtbare Ergebnisse. Politiker setzen lieber auf Projekte mit schnellerem Erfolg.
Datenschützer machen es neuen digitalen Lösungen schwer. Sie sehen Risiken für persönliche Daten und fordern aufwendige Sicherheitsmaßnahmen. Das bremst neue Systeme aus.
Technische Infrastruktur und Netzabdeckung
Deutschland liegt bei der digitalen Infrastruktur hinter anderen EU-Ländern zurück. Viele Behörden kämpfen mit langsamem Internet und alten Systemen.
Einige Ämter nutzen immer noch Hardware und Software aus den 2000ern. Moderne digitale Lösungen lassen sich damit kaum verbinden.
Die Netzabdeckung bleibt besonders auf dem Land schlecht. Behörden dort können digitale Dienste nicht zuverlässig anbieten.
Bürger greifen deshalb lieber auf bewährte Wege zurück. Sicherheitsbedenken halten IT-Abteilungen davon ab, neue Technologien einzusetzen. Sie setzen lieber auf abgeschlossene Systeme, was digitale Abläufe zwischen Behörden fast unmöglich macht.
Bund-Länder-Kompetenzstreit und föderale Spaltung
Das föderale System in Deutschland erschwert gemeinsame Digitalisierungsstandards. Jedes Bundesland entwickelt eigene Lösungen, statt zusammenzuarbeiten.
So entstehen 16 verschiedene Landessysteme für ähnliche Aufgaben. Das kostet Ressourcen und erschwert die Zusammenarbeit.
Der Bund kann den Ländern keine digitalen Standards vorschreiben. Das Grundgesetz setzt hier Grenzen.
Kompetenzstreitigkeiten verzögern wichtige Entscheidungen. Bund und Länder streiten oft jahrelang über Zuständigkeiten. Digitale Projekte kommen so kaum voran.
Praxisbeispiele: Fax und Digitalisierung im Bundesvergleich
Bayern geht mit einer klaren Fax-Bann-Initiative voran. Andere Bundesländer wählen eigene Wege zur Digitalisierung.
Modellprojekte zeigen schon heute, dass Verwaltung ohne Fax funktionieren kann.
Bayern: Rolle des Digitalministers und der Fax-Bann-Initiative
Digitalminister Fabian Mehring von den Freien Wählern hat Bayern zum Vorreiter gemacht. Im Dezember 2023 kündigte er an, dem Fax in der öffentlichen Verwaltung den Stecker zu ziehen.
Die bayerische Staatsverwaltung macht tatsächlich Fortschritte. Von 3.766 Faxgeräten in Ministerien und Behörden blieben bis August 2024 nur noch 1.869 übrig.
Das ist eine Reduktion um fast 50 Prozent in acht Monaten. Mehring sprach von „großen Schritten“ auf dem Weg durch die digitale Zeitenwende.
Der Fax-Bann betrifft aber nur die physischen Geräte. Faxen über Computer-Software bleibt möglich. Diese Lösung berücksichtigt rechtliche Vorgaben, die noch nicht komplett digitalisiert sind.
Andere Bundesländer im Vergleich
In Deutschland zeigt sich ein gemischtes Bild bei der Fax-Abschaffung. Bayern geht voran, andere Regionen ziehen nach.
Köln hat einen klaren Plan: Die Verwaltung soll bis 2028 auf Faxgeräte verzichten.
Frankfurt am Main hat schon stark reduziert. Von 2.500 Faxgeräten sind nur noch wenige Hundert übrig. Die Stadt will diese komplett abschaffen.
Der Bundestag hat den Schritt bereits gemacht: Im Juni 2024 verschwanden die letzten Faxgeräte. Der Ältestenrat hatte das schon 2021 gefordert.
Viele Gesundheitsämter und Gerichte nutzen Fax aber weiterhin als Standard. Gerade hier tut sich bei der Digitalisierung wenig.
Best Practices: Modellprojekte in der deutschen Verwaltung
Erfolgreiche Digitalisierungsprojekte zeigen, wie moderne Behördenkommunikation aussehen kann. Verschiedene Verwaltungsebenen probieren gerade neue Ansätze aus.
Pilotprojekte setzen inzwischen digitale Posteingänge statt Fax-Übertragungen ein. Bürger reichen ihre Dokumente verschlüsselt und rechtssicher online ein.
E-Government-Portale bieten schon heute Alternativen zum Fax:
- De-Mail für rechtssichere Kommunikation
- Online-Formulare mit digitaler Signatur
- Messenger-Systeme für den internen Austausch
Einige Ministerien setzen auf Cloud-basierte Dokumentenverwaltung. Papierausdrucke und Faxe werden dadurch wirklich überflüssig.
Einheitliche Standards sind für den Erfolg entscheidend. Zu viele verschiedene digitale Lösungen verwirren Bürger und Verwaltungsmitarbeiter eher, als dass sie helfen.
Schulungen für Behördenpersonal treiben den Wandel voran. Mitarbeiter lernen neue Tools kennen und verlassen sich weniger auf das Fax.
Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft
Veraltete Behördenprozesse machen Unternehmen das Leben schwer und schwächen Deutschlands Position im digitalen Wettbewerb. Bürger müssen sich mit umständlichen Abläufen herumschlagen, und die fehlende End-zu-End-Digitalisierung bremst die Innovationskraft des Landes aus.
Standortnachteil für Unternehmen durch analoge Behördenprozesse
Arbeiten Sie als Unternehmen in Deutschland? Sie verlieren täglich Zeit und Geld wegen alter Behördenprozesse. Während Länder wie Dänemark oder Estland längst digitale Verwaltungsverfahren anbieten, drucken Sie hier noch immer Formulare aus und schicken sie per Fax.
Diese Ineffizienz kostet Unternehmen:
- Personalkosten für die manuelle Bearbeitung von Papierdokumenten
- Zeitverluste bei Genehmigungen, oft 30-50% länger
- Opportunitätskosten wegen verzögerter Projektstarts
Ein Handwerksbetrieb wartet für eine Baugenehmigung oft mehrere Wochen, obwohl digitale Systeme das in wenigen Tagen schaffen könnten. Laut Bitkom-Umfrage nutzen 25% der Handwerksbetriebe noch Faxgeräte für die Behördenkommunikation.
Internationale Investoren sehen Deutschland mittlerweile kritisch. Besonders Tech-Unternehmen, die schnelle, digitale Prozesse gewohnt sind, schreckt die langsame Verwaltung ab.
Einfluss auf Bürgerfreundlichkeit und Servicequalität
Als Bürger spüren Sie die Folgen alter Verwaltungsstrukturen jeden Tag. Für einfache Anträge brauchen Sie persönliche Termine, Papierdokumente und Geduld – manchmal dauert es Wochen.
Ein paar Beispiele aus dem Alltag:
| Vorgang | Analog (Deutschland) | Digital (Vergleichsländer) |
|---|---|---|
| Wohnsitzanmeldung | Persönlicher Termin, 2-3 Wochen | Online, 5 Minuten |
| Gewerbeanmeldung | Mehrere Behördengänge | Ein digitaler Antrag |
| Steuererklärung | ELSTER + Papierbelege | Vollständig digital |
Die fehlende Ende-zu-Ende-Digitalisierung führt dazu, dass Sie als Bürger oft mitten im Prozess abbrechen müssen. Am Ende stehen Sie doch wieder beim Amt oder schicken Unterlagen per Post.
Gerade ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen leiden unter den starren, analogen Abläufen. Digitale Barrierefreiheit gibt es praktisch nicht, weil die Systeme fehlen.
Rolle der End-zu-Ende-Digitalisierung für Innovationsfähigkeit
Ohne durchgängige digitale Prozesse blockiert die Verwaltung Deutschlands Innovationskraft. Unternehmen können ihr Potenzial nicht ausschöpfen, wenn die Verwaltung analog tickt.
Die fehlende Ende-zu-Ende-Digitalisierung trifft besonders zukunftsweisende Branchen:
- KI-Unternehmen brauchen schnelle Zertifizierungen
- Fintech-Startups benötigen digitale Lizenzverfahren
- Gesundheits-Apps warten auf zügige Datenschutzprüfungen
Länder wie Singapur oder Südkorea gründen Unternehmen komplett digital in 24 Stunden. In Deutschland dauert das oft Monate – und kostet Nerven, Geld und vielleicht sogar die Chance auf den globalen Markt.
Die Bundesregierung spricht zwar vom Einsatz von KI-Sprachmodellen in Behörden. Aber solange Faxgeräte noch Alltag sind, klingt das eher nach Zukunftsmusik.
Herausforderungen beim Abschied vom Fax
Der Abschied vom Fax bringt jede Menge rechtlicher Hürden mit sich. Gleichzeitig stellen Justiz und Notfallkommunikation besondere Anforderungen an die Digitalisierung.
Rechtliche und sicherheitsrelevante Aspekte
Gesetzliche Verpflichtungen halten viele Behörden am Faxgerät fest. Manche Verfahrenshandlungen müssen weiterhin in Schriftform erfolgen.
Das Fax gilt rechtlich als sichere Übertragungsform. Viele Gesetze schreiben diese Technologie explizit vor. Gesetzesänderungen sind mühsam, aber notwendig.
Datenschutz-Anforderungen machen den Wechsel nicht einfacher. Digitale Alternativen müssen genauso sicher sein wie das Fax.
Rechtliche Herausforderungen:
- Veraltete Gesetze müssen angepasst werden
- Neue Technologien brauchen Nachweise für Rechtssicherheit
- Laufende Verfahren brauchen Übergangszeiten
- Mitarbeiter müssen neue rechtliche Rahmenbedingungen lernen
Ihre Verwaltung muss jede dieser Hürden einzeln prüfen und lösen.
Besondere Anforderungen in Justiz und Notfallkommunikation
Gerichte und Staatsanwaltschaften nutzen das Fax für zeitkritische Verfahren. Fristen müssen exakt eingehalten werden, und das Fax liefert hier bewährte Sicherheit.
Im Notfall dient das Fax als Backup-System. Fällt Internet oder Telefon aus, läuft das analoge Fax oft trotzdem.
Kritische Bereiche:
- Eilverfahren vor Gericht
- Kommunikation zwischen Rettungsdiensten
- Meldungen an Gesundheitsämter
- Übertragung vertraulicher Patientendaten
Die Abhängigkeit von digitaler Infrastruktur bereitet Sorgen. Cyberangriffe können ganze Verwaltungsbereiche lahmlegen.
Ihre Digitalisierung muss diese Ausfallsicherheit bieten. Alternative Kommunikationswege müssen so verlässlich funktionieren wie das Fax.
Zukunftsaussichten der digitalen Verwaltung in Deutschland
Deutschland steht jetzt an einem entscheidenden Punkt bei der Verwaltungsdigitalisierung. Neue Gesetze stecken den Rahmen ab, und der internationale Vergleich zeigt, wie dringend Handlungsbedarf besteht.
Digitalisierungsinitiativen von Bund und Ländern
Das Onlinezugangsgesetz (OZG) bleibt das Rückgrat der deutschen Verwaltungsdigitalisierung. Bis Mai 2023 standen im Schnitt 227 OZG-Leistungen deutschlandweit online zur Verfügung.
Das entspricht einem Plus von 42 Prozent in zwei Jahren. Trotzdem erreichen erst 39 Prozent aller Verwaltungsleistungen eine flächendeckende digitale Abdeckung.
Das eGovernment-Gesetz verpflichtet Bundesbehörden zur digitalen Transformation. Es sorgt für eine bessere Vernetzung zwischen den Behörden.
Die Bundesländer setzen die Vorgaben sehr unterschiedlich um. Hessen erreicht eine Nutzungsrate von 81 Prozent, Baden-Württemberg liegt bei nur 54 Prozent.
Basiskomponenten wie eID, E-Payment und Chat-Funktionen werden wichtiger. Immer mehr Bürger nutzen diese digitalen Werkzeuge, um mit Behörden zu kommunizieren.
Potenziale und notwendige Schritte zur Modernisierung
Die Nutzungsrate digitaler Verwaltungsleistungen stagniert bei 66 Prozent, obwohl das Angebot wächst. Verwaltungen müssen neue Zielgruppen erreichen.
Partizipationsangebote wie Mängelbeheber werden beliebter. Sie stärken das Vertrauen zwischen Bürgern und Verwaltung.
Die Verknüpfung verschiedener Verwaltungsebenen braucht noch viel Verbesserung. Bürger erwarten, dass kommunale, Landes- und Bundesangebote nahtlos ineinandergreifen.
Barrieren abbauen steht jetzt im Mittelpunkt. Gerade Menschen, die bislang keine Online-Services nutzen, brauchen bessere Zugänge.
Mehr Online-Dienste sind wichtig. Aber am Ende entscheidet die Qualität und Benutzerfreundlichkeit, ob digitale Verwaltung wirklich funktioniert.
Europäische Erwartungen und internationale Vergleiche
Estland und Finnland setzen echte Maßstäbe bei der Digitalisierung ihrer Verwaltungen. Die beiden Länder zeigen ziemlich eindrucksvoll, was mit einer konsequenten Umsetzung tatsächlich machbar ist.
Deutschland kommt im EU-Vergleich einfach nicht hinterher. Föderale Strukturen und der ständige Papierkram bremsen den Fortschritt weiter aus.
Die EU fordert von Deutschland schnellere Schritte in Richtung digitale Verwaltung. Europäische Programme bieten Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedsstaaten.
Strukturelle Hürden wie unterschiedliche IT-Systeme zwischen den Behörden machen einheitliche Lösungen schwer. Deutschland muss hier wirklich alle Verwaltungsebenen zusammenbringen und koordinieren.
Die digitale Infrastruktur in Deutschland erreicht noch längst nicht das Niveau von Straßen oder Stromnetzen. Um endlich aufzuholen, braucht es massive Investitionen.



